|
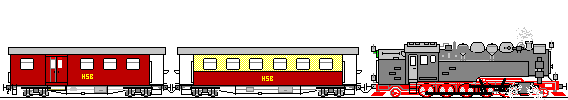 
Lexikon:
Alles Wissenswerte
von A - Z über die Eisenbahngeschichte
Abblasrohr
Senkrechtes Rohr im und unterhalb des Schornsteins
einer Dampflok. Der aus den Zylindern ausströmende
Dampf und der Rauch des Feuers werden hierdurch abgeblasen.
In der Rauchkammer entsteht dadurch ein Unterdruck, der
für den richtigen Zug des Feuers sorgt.
ABC-Raster
Teil der Beschriftung an Güterwagen.
Die Zahl in den Raster-Feldern gibt die zulässige Zuladung
in Tonnen bei Befahren der verschiedenen Streckenklassen
(A,B oder C) an.
Ablaufberg
Teil eines Rangierbahnhofes. Auf einer Rampe
verlaufendes Gleis. Die Güterwagen, die in einen Zug
eingereiht werden sollen, werden auf den A. geschoben, am
höchsten Punkt abgekoppelt, so daß sie an der
anderen Seite des A. herunterrollen. Im hinter dem A. liegendem
Weichenfeld (Gleisharfe) werden die Wagen den Zügen
zugeordnet; dies geschieht nur durch den Schwung der Wagen
und der Stellung der Weichen. Der A. dient zur Einsparung
von Loks im Rangierbahnhof - es wird nur eine Lok zur Verteilung
aller Wagen benötigt.
Abn
Siehe: Abnahme
Abnahme
Die Abnahme bezeichnet die Abschlussüberprüfung
eines Neubaufahrzeugs durch ein Ausbesserungswerk. Dieses
erteilt die Betriebserlaubnis wenn das Fahrzeug keine Mängel
aufweist. Das Fahrzeug wird dem Fahrzeughersteller damit
buchstäblich abgenommen, die technische Verantwortung
übernimmt ab diesem Zeitpunkt im weitesten der Auftraggeber.
Mit der Abnahme erhält ein Fahrzeug in der Regel eine
Zulassung von 6 Jahren, dann wird erstmals eine Revision
fällig.
Abrüsten einer
Lok
Versorgen einer Dampf- oder Diesellok mit
Kraft-/Betriebsstoffen (Kohle bzw. Diesel, Sand,...) und
die Durchführung einer technischen Kontrolle nach Abschluß
der Fahrt.
ABW
Außenbogenweiche
Siehe: Außenbogenweiche
Abzw
Abkürzung Abzweigstelle
Achsfolge
Konstruktionsmerkmal bei Loks, in Ziffern
und Buchstaben ausgedrückt. Letztere stehen für
die Treibachsen (B=2, C=3, D=4)
Siehe: Bauart und Achsfolge
Achssenke
Teil eines größeren Betriebswerkes.
Einrichtung, um einzelne Achsen (Radsatz) oder Drehgestelle
auszuwechseln. Der Wagen bzw. die Lok wird aufgebockt, um
die Achse absenken zu können.
Adhäsionsbetrieb
der zur Fortbewegung nötige Halt des
Triebfahrzeugs am Gleis erfolgt durch Haftkraft (bzw. Reibungskraft
beim Schleudern) zwischen Rädern und Schiene; im Gegensatz
zum Zahnradbetrieb
Adtranz
Adtranz bzw. ABB Daimler Benz Transportation
Adtranz war am 1. Januar 1996 durch den Zusammenschluß
der ABB Henschel und AEG - Daimler-Benz entstanden. Am 1.
Mai 2001 übernahm Bombardier Transportation Adtranz.
Siehe: Bombardier
AEG
Abkürzung Allgemeines Eisenbahngesetz
Akkumulator
chemischer Speicher für elektrische Energie
(Gleichstrom)
Siehe: Akkumulatoren-Fahrzeug
Akkumulatoren-Fahrzeug
elektrisch angetriebenes Fahrzeug, das seine
Energie aus Akkumulatoren bezieht. A. gelten als umweltfreundlich
und sind einfach aufgebaut. Ihr Aktionsradius ist durch
die Akkumulatoren-Spreicherkapazität stark begrenzt,
sie bedürfen stationärer Ladeeinrichtungen und
verhältnismäßig langer Stillstandszeiten
zum Aufladen der Akkumulatoren. Beispiel für ein A.
war z.B. die Baureihe 515
Siehe: Akkumulator
ALB
Abkürzung für Albanische Eisenbahn.
Ameisenbär
umgangsförmliche Bezeichnung für
den Wismarer Schienenbus
Amtrak
Abkürzung für "AMerican TRAnsportation
on TracK". 1970 gegründeter Zusammenschluß
der US-Eisenbahn-Gesellschaften, nur Personenverkehr.
Andreaskreuz
schräges Kreuz, Verkehrszeichen am Bahnübergang.
Anst
Abkürzung Anschlußstelle
ARA
Abkürzung Außenreinigungsanlage,
Waschstraße für Lok und Wagen
Asig
Abkürzung für Ausfahrsignal
Atlantic Bauart
Bauart von Dampflokomotiven mit Achsfolge
2’B1’.
Aufsb
Abkürzung Aufsichtsbeamter
Aufschneiden
1. gerät ein (scharf gelaufener) Spurkranz
zwischen Weichenzunge und das vorher anliegende Schienenprofil,
so wird die Weiche aufgeschnitten und es kommt zur Entgleisung
2. in der Modelleisenbahnsprache auch für Auffahren
einer Weiche
Ausbesserungswerk
Große Werkstätte zur Instandhaltung
von Loks sowie der Durchführung großer Reparaturen.
Abkürzung: AW.
Außenbogenweiche
Bogenweiche mit entgegengesetzten Krümmungen
der beiden Gleisbögen, auch Y-Weiche (Dreiwegweiche
ohne Mittelzweig)
Ausschlacken
Entfernen von Verbrennungsrückständen
(Schlacke, Asche und Lösche) aus Dampfloks.
Ausschlackungsanlage
Teil des BW’s. Dient zum Ausschlacken
von Dampfloks.
AW
Siehe: Ausbesserungswerk
Awanst
Abkürzung für Ausweichanschlußstelle
B
Hauptzeichen für Reisewagen 2. Klasse
Bahn TV
Mitarbeiterfernsehen der Deutschen Bahn Fernsehsendungen
zum Thema Eisenbahn finden Sie hier Eisenbahn im TV.
Bahnbetriebswerk
Anlage zur Behandlung und Unterhaltung der Triebfahrzeuge.
Ein B. dient der Auffüllung der Brennstoffvorräte
(Bei Dampf- und Dieselloks), dem Abstellen sowie dem wieder
Einsatzbereitmachen der Loks. Je nach Art des BW’s
sind verschiedene Einrichtungen vorhanden. Die heutigen
Diesel- und Elektrolok-BW’s dienen hauptsächlich
zum Abstellen und Reparieren der Fahrzeuge.
Bahnpostwagen
Wagen der Bundespost, in dem Briefe, Pakete etc. transportiert
werden. Das Sortieren der Post findet während der Fahrt
statt.
BASA
Abkürzung Bahnselbstwählanschluss, ehem. bahneigenes
Telefonnetz das Netz gehört inzwischen zu Arcor
Bauart und Achsfolge
1= eine im Hauptrahmen gelagerte Laufachse
1'= eine vom Hauptrahmen unabhängige Laufachse
2'= zwei, in einem Drehgestell vereinigte Laufachsen
A= eine angetriebene Achse im Hauptrahmen
B= zwei miteinander gekuppelte Antriebsachsen im Hauptrahmen
C= drei miteinander gekuppelte Antriebsachsen im Hauptrahmen
D= vier etc.
B'= zwei miteinander gekuppelte Treibachsen, die in einem
Drehgestell laufen
Bo= zwei einzeln angetriebene Achsen in einem Rahmen
Bo'= zwei einzeln angetriebene Achsen in einem Triebgestell
B'B'= je zwei miteinander gekuppelte Treibachsen in zwei
verschiedenen Drehgestellen
Beispiele (o=Laufachse, O=Treibachse): 1A1 oOo (Adler)
2B ooOO (Die General USA)
2'C1' ooOOOo (BR 01)
2C2 ooOOOoo (Hudson J-3a USA)
1'D1' oOOOOo (BR 41)
2DD2 ooOOOOOOOOoo (Big Boy USA)
Bei Dampflokomotiven wird nach der Angabe der Radsatzanordnung
vermerkt:
- die Dampfart (h=Heißdampf, n=Naßdampf),
- die Zahl der Zylinder,
- die Art der Dampfdehnung (ohne Zeichen=einfach Dampfdehnung,
v=Verbundwirkung).
Bei Tendern folgt nach der Angabe der Radsatzanordnung der
Buchstabe "t" und das Fassungsvermögen des
Wasserkastens in m³.
Siehe: Innenbogenweiche
Baureihe
Bezeichnung zur Unterscheidung der Triebfahrzeuge nach
wichtigen Punkten; z.B. der Art: Dampf-, Diesel-, E-Lok...,
sowie der Ausführung. Abkürzung BR.
Baureihenbezeichnungen bei Dampflokomotiven
Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) führte
1925 Baureihenbezeichnungen ein:01 bis 19 Schnellzuglokomotive
20 bis 39 Personenzuglokomotive 40 bis 59 Güterzuglokomotive
60 bis 79 Schnellzug- und Personenzugtenderlokomotive 80
bis 96 Güterzugtenderlokomotive 97 Zahnradlokomotive
98Lokalbahnlokomotive 99 Schmalspurlokomotive
BBÖ
Epoche II-Abk. der Bundesbahnen in Österreich (bis
1938); Vorläufer der ÖBB
BD
1.) Abk.: Bundesbahndirektion der DB
2.) Hauptzeichen für Reisezugwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil
BDZ
Abkürzung für Bulgarische Staatsbahnen.
Bekohlungsanlage
Teil eines Dampf-BW’s. Dient dem Auffüllen des
Tenders einer Dampflok mit Kohle. Die Kohle wird vor dem
Bekohlen abgewogen.
Besandungsanlage
Teil des BW’s, der zum Auffüllen der Sandbehälter
von Loks mit Streusand dient.
Betra
Abkürzung für Betriebs- und Bauanweisung
Bf
Abkürzung für Bahnhof
Bfo
Abkürzung für Bahnhofsfahrordnung
Bk
Abkürzung für Blockstelle
Siehe: Blockstelle
Bksig
Blocksignal
Blockstelle
Bahnanlage, die eine Blockstrecke begrenzt. Eine Blockstelle
kann zugleich als Bahnhof, Abzweigstelle, Überleitstelle,
Anschlussstelle, Haltepunkt, Haltestelle oder Deckungsstelle
eingerichtet sein.
Siehe: Bk
BLS
Abk.: Bern-Lötschberg-Simplon-Eisenbahn
BoBo
Achsfolgebezeichnung für zwei Drehgestelle mit jeweils
zwei einzelnangetriebenen Achsen, eigentlich Bo'Bo'
Siehe: Bauart und Achsfolge
Bogenweiche
Weiche mit zwei gekrümmten Zweigen, wegen der Seltenheit
der Außenbogenweiche meist kurz für Innenbogenweiche
Bombardier
Bombardier Transportation ist weltweiter Marktführer
in der Schienenverkehrstechnik und den damit verbundenen
Dienstleistungen. Das breite Produktangebot umfasst Schienenfahrzeuge
für den Personenverkehr, komplette Schienenverkehrssysteme,
Lokomotiven, Güterwagen, Antriebstechnik und Zugsteuerung
sowie Signaltechnik und -systeme. Am 1. Mai 2001 übernahm
Bombardier Transportation mit der Adtranz eines der grössten
Unternehmen in der internationalen Schienenverkehrsindustrie.
Siehe: Adtranz
Booster
meist in ein Drehgestell eingebautes Zusatztriebwerk, das
dem kurzzeitigen Leistungszuwachs dient - etwa beim Anfahren.
Der Booster war bei US-amerikanischen Loks verbreiteter
als hierzulande.
Borsig
ehemalige Lokomotivfabrik in Berlin
Boxpok-Rad
gelochtes Scheiben-Lokrad, das für höhere Achslasten
konstruiert wurde.
BR
1. Abkürzung für British Railways: Britische
Eisenbahnen.
2. Abkürzung für Baureihe
Bremszettel
Dokument für den Lokführer mit Angaben über
Wagenanzahl und Zugmasse
Bstg
Abkürzung für Bahnsteig
Bubikopf
Spitzname der Tenderlok BR 64
Buchfahrplan
Der Buchfahrplan ist der Fahrplan des Triebfahrzeugführers.
Hier sind sämtliche auf der Strecke gelegenen Bahnhöfe,
Haltepunkte und Blocksignale aufgeführt. Dabei steht
die Ankunftszeit, die Abfahrtzeit und sonstige Informationen
wie Gefälle der Strecke, besondere Signale andere Besonderheiten,
z.B. Hinweise auf Oberleitungssignale oder Frequenzen für
den Zugbahnfunk.
Siehe: EBuLa, La
Bügel
salopper Audruck für den Dachstromabnehmer bei E-Loks,
Fachausdruck = Pantograph
Bügeleisen
Spitzname für meist 3-achsige Klein-E-Lok mit abgeschrägten
Vorbauten
Bügelfalten-Lok
Spitzname der DB E-Lok 10 mit stömungsgünstigem
Lokkasten
Bw
Abk.: Bahnbetriebswerk
Siehe: Bahnbetriebswerk
Bww
Bahnbetriebswagenwerk, Wartungs- und Reparaturstätte
für Wagen
C
Hauptzeichen für Reisewagen 3. Klasse
Catch me who can
Eine der ersten Lokomotiven der Welt. Die 1808 vom Briten
Trevithick gebaute Lok war damals eine Art Parkbahn und
Attraktion für Wohlhabende.
CFL
Abkürzung für Société National
des Chemins de fer Luxembourgeois: "Nationale Gesellschaft
der Luxemburgischen Eisenbahnen".
CH
Abkürzung für Chemins de fer de I’Etat Héllénique:
Griechische Staatsbahnen.
CIR-ELKe
Abkürzung Computer Integrated Railroading, mit CIR-ELKE
wird die Linienzugbeeinflussung, als "LZB 90"
bezeichnet, eine umfangreiche Funktionserweiterung erfahren
(z.B. bei Fahrten im Bahnhofsbereich, beim Rangieren, bei
der Disposition etc.).
Siehe: LZB
CIWL
Abk. für "Compagnie Internationale de Wagon-Lits"
(internationale Schlaf- und Speisewagengesellschaft)
CoCo
Achsfolgebezeichnung für zwei Drehgestelle mit jeweils
drei einzeln angetriebenen Achsen, eigentlich Co'Co'
Siehe: Bauart und Achsfolge
Containerterminal
Umschlagplatz für Container. Die Container werden
mit einem Containerkran von den LKW’s auf die Containerwagen
umgeladen und umgekehrt.
CSD
Abkürzung für "Ceskoslovenke Statni Drahy"
Tschechoslowakische Staatsbahnen. Seit der Trennung der
Tschechoslowakei in Tschechien und Slowakei aufgelöst.
Culemeyer
Schwerlastfahrzeug zum Transport von Schienenfahrzeugen
auf der Straße
D
Hauptzeichen für Gepäckwagen
DB
Am 1. Januar 1994 wurde die Deutsche Bahn AG (DB - ehemals
Deutsche Bundesbahn) gegründet. Das Unternehmen übernahm
von der Deutschen Bundesbahn als auch von der Deutschen
Reichsbahn alle Triebfahrzeuge.
DB AG
Deutsche Bahn AG, ab 1995
DB Cargo
Geschäftsbereich Güterverkehr der DB AG
Deckungssignal
Hauptsignal zur Sicherung von Gefahrenpunkten, wie z.B.
bewegliche Brücken, Gleiskreuzungen usw. Aussehen:
quadratische, weiße Scheiben mit schwarzem Rand.
DELTA
Elektronisches Fahrsystem von Märklin
Dieselelektrischer Antrieb
Antriebssystem, bei dem Dieselmotoren elektrische Generatoren
antreiben, die Strom erzeugen und damit wiederum Elektromotoren
antreiben, die eigentlichen Antriebsmotoren.
Digital
Modelleisenbahn: Elektronisches Mehrzug-Fahrsystem mehrerer
Hersteller
Diorama
Miniaturthema; Anlagenausschnitt
Diorama
Modellbahn: ausschnittsweise künstliche Darstellung
einer Landschaft mit hohem Detail- und Realitätsanspruch
DKW
Abkürzung: Doppelkreuzungsweiche
Donnerbüchse
Ab 1929 gebaute zweiachsige Personenwagen mit Tonnendächern,
die wegen des Lärms während der Fahrt den Spitznamen
D. bekamen.
Doppelstockwagen
Wagen, die zwei Etagen haben. D. gibt es bei fast allen
europäischen Bahngesellschaften, insbesondere bei der
ehemaligen Deutschen Reichsbahn DR.
DPT
Deutscher Eisenbahn-Personen-, Gepäck-, und Expreßguttarif.
Im allgemeinen meint man damit Fahrpreise und Fahrkarten,
die nach dem Tarif der Deutschen Bahn AG ausgestellt wurden.
(Gegensatz dazu ist z. B. der Tarif eines Verkehrsverbundes,
in dem die Bahn mit einbezogen ist).
Weitere Infos unter: DPT-online.de
DR
1. Abkürzung für Deutsche Reichsbahn, Bahngesellschaft
der ehemaligen DDR, ca. 14.000 km Strecke.
2. Abkürzung für Deutsche Reichsbahn. Bis 1945
bestehende gesamtdeutsche Eisenbahn, die 1920 als Nachfolger
der Länderbahnen gegründet wurde.
Draisine
Nach dem Erfinder Karl Freiherr con Drais benanntes 2achsiges
Schienenfahrzeug. Die D. wurde früher per Hand oder
Fuß angetrieben, heute mit kleinem Verbrennungsmotor.
Drehscheibe
Auf einer Scheibe montierte Gleise, die das Drehen und
Versetzen von Lokomotiven ermöglicht. Insbesondere
Dampflokomotiven mußten früher gedreht werden,
da einige von ihnen nicht so schnell rückwärts
fahren konnten.
Dreikuppler
Dampflokomotive mit drei durch Kuppelstangen gekuppelte
Achsen.
Dreileiter
Modelleisenbahn: Begriff für Stromsysteme mit Gleisen
und zusätzlichem Mittelleiter
DRG
Abkürzung: "Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft",
1920-1945
Drucktastenstellwerk, Dr-Stellwerk
Art eines Gleisbildstellwerks, benannt nach den Drucktasten
zur Bedienung. Andere Gleisbildstellwerk-Typen: elektro-mechanisches
Stellwerk und elektrisches Stellwerk.
DSB
Abk.: Dänische Staatsbahn
DSG
Abk. für "Deutsche Schlaf- und Speisewagen-Gesellschaft"
bei der DB bis 1994.
EBA
Abkürzung Eisenbahnbundesamt, Das EBA ist Aufsichts-
und Genehmigungsbehörde für die Eisenbahnen im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
Siehe: Eisenbahnbundesamt
EBO
Abkürzung Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
Siehe: Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
EBuLa
Abkürzung Elektronischer Buchfahrplan und La.
Siehe: Buchfahrplan, La
EC
Abkürzung für EuroCity. Komfortabler, grenzüberschreitender
Schnellzug.
Eierkopf
Dieseltriebwagen (VT 08.5 / VT 12.5 mit gerundetem Kopf)
Einfahrsignal
Hauptsignal, das den Bahnhof absichert und die Einfahrt
regelt.
Einheits-Bauart
Nach dem Zusammenschluß der Länderbahnen zur
DB wollte man die unterschiedlichen Lokbauarten der einzelnen
Länderbahnen vereinheitlichen. Die von da an gebauten
Loks waren Einheitsbauarten.
Einheitslokomotive
Lokomotive, deren wesentliche Bauteile mit denen andererEinheitsloks
getauscht werden können, also vereinheitlicht sind,
was Kosteneinsparungen bei Konstruktion, Fertigung und Reparatur
nach sich zieht.
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
Rechtsverordnung des Bundesministers für Verkehr über
den Bau und Betrieb von regelspurigen Eisenbahnen des öffentlichen
Verkehrs in der Bundesrepublik Deutschland.
Siehe: EBO, ESO
Eisenbahnsignalordnung
Rechtsverordnung des Bundesministers für Verkehr für
eine einheitliche Anwendung der Signale. Sie legt verbindlich
die Formen, Farben und Klangarten sowie den Verwendungszweck
der Signale fest.
Siehe: ESO
EIU
Abkürzung Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Der Unternehmenszweck
eines EIU ist das Betreiben einer Eisenbahninfrastruktur.
Dazu gehören die Vorhaltung der Schienenwege, die Fahrplankonstruktion
und die Führung von Betriebsleit- und Sicherungssystemen.
EKW
einfache Kreuzungsweiche
Elektrisches Stellwerk
Anstatt der Relais werden elektronische Bauelemente zur
Steuerung der Weichen/Signale benützt.
Siehe: ESTW
Elektromechanisches Stellwerk
Stellwerk, das elektrische und mechanische Elemente zum
Stellen benötigt. Stellhebel mit Kontakten geben je
nach Stellung Strom bzw. kein Strom auf die Schaltrelais,
die die Fahrstraßen schalten. Die Relais steuern die
Signale und die Elektromotoren der Weichen.
Epoche I
Länderbahnzeit (1890 bis ca. 1925)
Epoche II
Reichsbahnzeit (DRG 1925 bis 1945)
Epoche III
Aufbauzeit (DB/DR 1945 bis 1970)
Epoche IV
EDV-Nr.-Zeitalter (1970 bis 1990)
Epoche V
ICE-Zeitalter (ab 1990)
ES
Abk.: Elektro-Steuerwagen
Eselsrücken
Siehe: Ablaufberg
ESO
Abkürzung Eisenbahnsignalordnung.
Siehe: Eisenbahnsignalordnung
ESTW
Abkürzung elektronisches Stellwerk
Siehe: Elektrisches Stellwerk
ET
Abk.: Elektro-Triebwagen
ETCS
Abkürzung European Train Control System. ETCS soll
die vielen verschiedenen Zugsicherungssysteme in den europäischen
Ländern ablösen, und eine dichte, schnelle und
grenzüberschreitende Zugführung in ganz Europa
ermöglichen.
Eurofima
Abkürzung für Europäische Gesellschaft für
die Finanzierung von Eisenbahnmaterial. Bekannt wurde die
E. durch die Beschaffung von rund 500 einheitlichen Wagen,
die häufig E.-Wagen genannt werden.
Eurovapor
Europäische Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen
- besonders von Dampflokomotiven.
EVO
Abkürzung Eisenbahn-Verkehrsordnung
EVU
Abkürzung Eisenbahnverkehrsunternehmen. Eisenbahnunternehmen,
dessen Unternehmenszweck in der Durchführung von Zugverkehr
auf einer von einem Eisenbahninfrastrukturunternehmen betriebenen
Eisenbahninfrastruktur besteht.
EW
einfache Weiche
Fahrdienstleiter
Bahnmitarbeiter, dem auf den ihm zugeordneten Betriebsstellen
eigenverantwortlich die Zulassung der Zugfahrten obliegt.
Siehe: Fdl
Fahrdraht
Teil der Oberleitung. Der F. ist der Teil der Fahrleitung,
von der der Stromabnehmer den Strom abnimmt.
Fahrleitung
Fahrdraht, Tragwerk und Hänger (Aufhängung) ergeben
zusammen die F. , auch Oberleitung genannt.
Fahrstraße
Vom Stellwerk geschalteter Weg eines Zuges durch das Weichenfeld
eines Bahnhofes. Heute werden F. in modernen Stellwerken
automatisch geschaltet. Es muß nur eine Start- und
eine Zieltaste gedrückt werden, um die F. zu erstellen.
Fairlie
Bauart einer Gelenk-Dampflok ähnlich der Bauart Garret
mit zwei Langkesseln im Gegensatz zur Bauart Meyer mit nur
einem Kessel.
Faltenbalg
Wagenübergang zwischen älteren Reisezugwagen.
Der F. kann auseinandergezogen und zusammengedrückt
werden. Beim Kuppeln von Wagen mit F. müssen die Faltenbälge
ebenfalls verbunden werden.
Fangbügel
Sicherheitseinrichtung zum Auffangen beispielsweise der
Treibstange einer Dampflok bei Kreuzkopf- oder Stangenschäden
FD
Fern-D-Zug
Fdl
Abkürzung Fahrdienstleiter
Siehe: Fahrdienstleiter
Feldbahn
Schmalspurige Arbeitsbahn im Wald- oder Grubendienst
Feuerbüchse
Teil einer Dampflok, wo der Brennstoff verbrannt wird.
Feuerrost
Teil der Feuerbüchse, wo das Feuer brennt und die
Schlacke abfällt.
Flankenschutz
Maßnahme, die verhindern soll, dass Fahrzeuge über
einen einmündenden Fahrweg in eine sicherungstechnisch
freigegebene Fahrstraße gelangen können. Es wird
zwischen mittelbarem und unmittelbarem Flankenschutz unterschieden.
Flex
Flensburg Express, Die Flex AG befuhr von Ende 2002 bis
zur Insolvenz (im August 2003) die Strecke Padborg (DK)
- Flensburg - Hamburg.
Flügelrad
Symbol der K.W.St.E., welches bis etwa 1920 verwendet wurde.
Flügelsignal
Älterer Signaltyp, bei dem es bereits Vor- und Hauptsignale
gibt. Die Form-Hauptsignale zeigen rot bzw. grün über
die Stellung der rot/weißen Signalflügel an.
Bei Form-Vorsignalen übernimmt dies eine runde orange
Scheibe. F. besitzen rote und grüne Signalblenden,
die sich je nach Stellung über das Licht schieben.
FMZ
Abk. für "Fleischmann-Mehrzug-Steuerung"
FMZ
Abk. für frequenzmultiplexe Zugsteuerung. selektive
Türsteuerung bei Doppelstockwagen u.a.
Fotoanstrich
graue oder hellblaue Lokfarbe, nur vor Ablieferung neuer
Loks an die Bahngesellschaften
Fplo
Abkürzung für Fahrplananordnung
FS
Abkürzung für Ferrovie dello Stato: Italienische
Staatsbahn.
Fünfkuppler
Dampflokomotive, bei der je 5 Räder über Kuppelstangen
miteinander verbunden sind.
G
1.) Modelleisenbahn: Spurweite IIm (Großbahn);
2.) Hauptzeichen für gedeckte Güterwagen
Garret
Bauart einer Gelenk-Dampflok, bei der zwei Dampfdrehgestelle
einen gestreckten Rahmen tragen; die Garret-Bauart fand
vor allem in Afrika Verbreitung
Gelenk-Lok
Lok mit hoher Leistung in Verbindung mit niedriger Achslast
und guter Kurvenläufigkeit durch Einbau von drehbar
gelagerten Treibachsen, z.B. Bauart Mallet, Garret, Fairlie,
Meyer
Geschwindigkeits-Aussteuersignal
Nebensignal an Bahnhofsausfahrten. Es steht nach der letzten
Weiche. Es bedeutet, daß schnelle Züge, besonders
der ICE, ab hier voll beschleunigen dürfen. Das G.
ist eine pfeilförmige weiße Tafel mit schwarzem
Rand.
Gläserner Zug
Elektrischer Aussichtswagen, von dem 1936 nur zwei Exemplare
gebaut wurden. Der Triebwagen trägt eine blau-weiße
Farbgebung. Er hat die Nummer 491 001-4.
Gleis
Ein Gleis setzt sich aus linker und rechter Schiene sowie
aus Schwellen zusammen.
Gleisharfe
Ein Gleis verzweigt sich über Weichen zu einer G.
Die einzelnen Gleise der G. liegen meist parallel. G. findet
man häufig in Rangierbahnhöfen.
Gleissperrsignal
Signal, welches Zug- und Rangierfahrten auf einem Gleis
verbietet. Das G. ist eine runde weiße Scheibe, die
drehbar gelagert ist. Wenn der schwarze Balken auf der Scheibe
waagerecht steht, ist das Gleis gesperrt, wenn er senkrecht
steht, ist es frei.
Gleisstellbild
Elektrisches Stellwerk mit einem Gleisbildstelltisch, auf
dem die Gleise des Bahnhofes/der Strecke abgebildet sind.
Die Bedienung erfolgt über Drucktasten (Drucktastenstellwerk).
Siehe: Drucktastenstellwerk, Dr-Stellwerk
Gleiswaage
Einrichtung, um Schienenfahrzeuge, insbesondere Güterwagen,
zu wiegen. Die Gleise sind ununterbrochen. Zum Wiegen wird
das Fahrzeug mittels der Waagenbrücke angehoben.
Gleiswendel
Modellbahn: wendelförmige Strecke zum Überwinden
großer Höhenunterschiede
H0
Modelleisenbahn: Spurweite, Maßstab 1:87 (Halb 0;
daher gesprochen Ha-Null)
Halbspeisewagen
Typ "Kakadu" rot/blau (mit 1. Klasse-Abteilen)
bzw. rot/grün (mit 2. Klasse-Bereich); Epoche III
Hauptsignal
Signal, welches anzeigt, ob eine Strecke frei oder besetzt
ist bzw. ob die Einfahrt in den Bahnhof gestattet ist oder
nicht (Einfahrsignal). Ebenso, ob die Ausfahrt gestattet
ist.
Hauptstrecke
Strecke mit Personen- und Güterverkehr, teilweise
auch Fernverkehr, Gegenteil Nebenstrecke. Die Mehrzahl der
H. in Deutschland sind elektrifiziert.
Hebelstellwerk
Stellwerk, bei dem das Stellen der Weichen/Signale mit
Stellhebeln geschieht. Die Übertragung ist nicht elektrisch,
sondern mechanisch über Seilzüge.
Heberlein-Bremse
erste durchgehende Seilzugbremse Mitte 19. Jhdt., das Seil
verlief über die Dächer der Wagen
Hechtwagen
Reisewagengattung mit keilförmigen Enden (Ep. II und
III)
Heißdampflok
Bauart einer Dampflok, bei der der vom Wasser getrennte
Dampf derart erhitzt wird, daß er nur in geringem
Maße im Zylinder kondensiert, wodurch der Kohle- und
Wasserverbrauch im Vergleich zur Naßdampf-Lok geringer
ausfällt.
Heizer
Der Heizer einer Dampflok muß für den regelmäßigen
Brennstoffnachschub sorgen und dem Lokführer zur Hand
gehen.
Hemmschuh
Gerät aus Stahl, welches zum Abbremsen und zur Sicherung
gegen eine evtl. Wegrollen dient. Der H. wird von Hand auf
eine Schiene des Gleises gesetzt.
Heusinger-Steuerung
weitverbreitete Einrichtung zur Dampfverteilung in die
Zylinder einer Dampflok (nach Ing. Eduard Heusinger, *1817)
Hobby
Modelleisenbahn: Einsteigersortimente von Märklin
(H0) und Arnold (N)
Hp
1. Haltepunkt
2. Hauptsignalbegriff (mit folgender Nummer)
Huckepackverkehr
Transportmethode, bei der ein Fahrzeug auf einem anderen
transportiert wird. Beispiel für H.: Schmalspurwagen
auf Normalspurwagen, Lkw auf speziellen Güterwagen
(RoLa).
Hundeknochen
Modelleisenbahn: Modellanlagenprinzip in Form eines gestauchten
Ovals. Auffallend dabei: 2 Kehren an den Enden und die lange
Fahrstrecke dazwischen.
Hydrodynamische Bremse
Die hydrodynamische Bremse besteht im Prinzip aus einem
Bremsmotor, der über eine Welle mit den Achsen der
Lok verbunden ist, und einem Stator. Beide Teile sind in
ein Bremsgehäuse eingebaut. Im Bremsbetrieb wir das
Bremsgehäuse mit dem Hydrauliköl des Turbogetriebes
gefüllt. Der mitlaufene Rotor beschleunigt das Öl,
das gleichzeitig vom Stator gehemmt wird, dadurch bremst
die Maschine. Die freiwerdende Energie wird in Wärme
umdewandelt und abgeführt. Die Steuerung der Bremse
erfolgt mit Hilfe des Fahr- und Bremsschalters.
I
Kennung für Spur I (Eins); Spurweite 45 mm; Maßstab
1:32
IBW
Innenbogenweiche
Siehe: Innenbogenweiche
IC
Abkürzung für InterCity. Der IC-Verkehr wurde
1971 aufgenommen. Speziell für die IC’s wurden
neue Loks beschafft (BR103), die 200 km/h schnell sind.
Anfangs bestanden IC’s nur aus 1. Klasse-Wagen und
fuhren alle 2 Stunden. Seit 1979 fahren die meisten IC’s
im Stundentakt und verfügen über 2.Klasse-Wagen.
ICE
1.) Abkürzung für InterCityExpress. Der ICE ist
seit 1991 im planmäßigen Einsatz. Inzwischen
gibt es verschiedene Baureihen ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T
und ICE-TD. 2.)Abkürzung auch für den InterCityExperimental
(auch ICE-V). 1985 wurde der ICE-V zu Versuchszwecken in
Dienst gestellt. Am 1.Mai 1988 stellte diese Einheit mit
406 km/h einen neuen Wewltrekord auf. Der ICE-V hat die
Baureihe 410/810.
II
Modelleisenbahn: Spurweite II; Maßstab 1:22,5
IIm
Modelleisenbahn: meterspuriger Maßstab 1:22,5
Indizierte Leistung = PSi
Bei Dampflokomotiven ist die Leistung in PS im Zylinder
angegeben; diese ist höher als die "effektive"
Leistung am Zughaken, da die Lokomotive Leistung benötig,
um ihren eigenen Fahrwiderstand und die Reibungsverluste
im Triebwerk zu überwinden (PSe = Leistung am Zughaken).
InduSi
Abkürzung für Induktive Zugsicherung. Die InduSi
wurde bereits 1930 entwickelt. Seitlich vom Gleis liegende
Elektromagnete sind von der Signalstellung beeinflußt.
Der Lokführer muß beim Überfahren eines
Gleismagnetes eine Wachsamkeitstaste drücken. Versäumt
er dies, wird eine Zwangsbremsung ausgelöst.
Siehe: LZB
Innenbogenweiche
Bogenweiche mit zwei gekrümmten Zweigen der gleichen
Richtung
IR
InterRegio (Nachfolger des D-Zuges)
Jacobs-Drehgestell
ein Drehgestell, das zwei benachbarte Wagenkästen
trägt, also zwei herkömmliche Drehgestelle ersetzt
Jumbo
Spitzname der schweren Güterzug-Tenderlok BR 44
K.Bay.Sts.B.
Abkürzung für Königlich Bayerische Staatsbahn.
Von 1844 bis1920 bestehende Bahngesellschaft des Königreiches
Bayern.
K.Sächs.Sts.E.B.
Abkürzung für Königlich Sächsische
Staatseisenbahn. Eine der Länderbahnen.
K.W.St.E.
Ist die Abkürzung für Königlich Württembergische
Staatseisenbahnen. Die K.W.St.E. haben das Flügelrad
als Symbol getragen.
K.W.St.E.B.
Abk.: Königlich Württembergische Staatseisenbahn
Kabinentender
Besondere Tenderform mit Kabine für das Begleitpersonal
von Güterzügen, z. B. bei der DB-Schlepptenderlok
BR 50
Kakadu
Halbspeisewagen; Restaurantteil rot lackiert, 1.-Klasse-Abteile
blau
Kehrschleife
Gleisbild, das Lok und Wagen in Gegenrichtung zurückführt
Kennzeichnung der Triebfahrzeuge
ab 1.1.1968 0=Dampflokomotive 1= Elektrolokomotiven 2=
Brennkraftlokomotiven 3= Kleinlokomotiven aller Antriebsarten
4= Elektrotriebwagen 5= Akkutriebwagen 6= Brennkrafttriebwagen
7= Schienenbusse und Diensttriebwagen 8= Steuer-, Bei- und
Mittelwagen zu Elektrotriebwagen 9= Steuer-, Bei- und Mittelwagen
zu Brennkrafttriebwagen
Kessel
Teil der Dampflok, wo das Wasser verdampft wird und sich
ein hoher Dampfdruck aufbaut.
Kesseldruck
Dampfdruck im Kessel einer Dampflok. Er beträgt bei
einem Hochdruckkessel bis zu 16 atü.
Kittel
Dampftriebwagen; urspr. württ. Bauart
KöF
Kleindiesellok (k=klein, ö=Öl-/Dieselgetrieben,
f=Flüssiggetriebe)
Kohlenstaub-Lokomotive
Dampflok mit Kohlenstaubfeuerung: Anstatt der normalerweise
verwendeten Kohle, wird bei der K. Kohlenstaub als Brennstoff
benutzt. Der Kohlenstaub wird vom Tender in den Kessel geblasen.
Bei der DR (DDR) wurden über 100 K. eingesetzt.
KPEV
Königlich Preussische Eisenbahn Verwaltung. Die KPEV
war die größte Eisenbahngesellschaft Deutschlands
vor dem Zusammenschluß der Länderbahnen zur Deutschen
Reichsbahn (DR). (K.P.E.V.)
Kreuzen
Das Begegnen von Zügen entgegengesetzter Fahrtrichtung
an einer Ausweichstelle einer sonst eingleisigen Strecke
Kriegslok
Dampf- und E-Loks, bei denen kriegsbedingt auf Bauteile
verzichtet wurde oder diese vereinfacht wurden, bekanntestes
Beispiel BR 52
Krokodil
Spitzname der Be 6/8 III oder früher Ce 6/8 II der
SBB
Kuhfänger
Im amerikanischen Mittelwesten besaßen die Dampfloks
vorn große Gitter zum Schutz vor Vieh, da es früher
kaum abgezäunte Weiden gab.
Kursbuch
Das K. ist eine Zusammenfassung aller Fahrpläne. Die
einzelnen Strecken sind nach Streckennummern geordnet. Kursbücher
gibt es nicht nur im Personen-, sondern auch im Güter-
und im internationalen Verkehr.
Kurswagen
Wagen eines Zuges, der vom normalen Zuglauf abweicht, das
heißt er fährt einen Teil der Strecke mit einem
Zug mit und wird dann in einem Bahnhof abgekoppelt, um alleine
oder mit einem anderen Zug weiterzufahren.
L
Signaltafel "Läuten" (steht neben Bahngleisen)
La
Abkürzung Verzeichnis der vorübergehenden Langsamfahrstellen.
Hier sind Beschränkungen aufgeführt, die im Buchfahrplan
nicht dargestellt sind, sich also kurzfristig ergeben haben
oder nur vorübergehend gelten.
Siehe: Buchfahrplan
Ladelehre
Siehe: Lademaß, Lichtraumprofil
Lademaß
Auch Ladelehre genannt. Das L. ist ein Rahmen aus Metall,
der die Masse des Lichtraumprofils hat. Das L., welches
häufig nahe bei der Gleiswaage steht, dient der Kontrolle,
ob ein Güterwagen überladen ist.
Siehe: Lichtraumprofil
Länderbahnen
L. ist der Oberbegriff für die Eisenbahnen der ehemaligen
Länder Baden, Bayern, Hessen, Mecklenburg, Oldenburg,
Preussen, Sachsen und Württemberg, welche 1920 zur
Deutschen Reichsbahn (DB) zusammengefaßt wurden.
Lätzchen
Umgangsförm.: für das weiße Fünfeck
auf rotem Grund bei Epoche-V-Lokomotiven
Laufachse
Nicht angetriebener Radsatz. Die L. dient der Verbesserung
der Laufeigenschaften von Lokomotiven.
Laufschild
Außen am Reisezugwagen angebrachtes Schild, welches
den Start- und Zielbahnhof sowie den Zuglauf angibt.
Leerlaufachse
Siehe: Laufachse
Leig
Abkürzung: "Leichter Güterverkehr",
Epoche III
Lf-Signal
Langsamfahr-Signal
LGB
Modelleisenbahn: Hersteller von Spur IIm-Fahrzeugen, Schienen
und Zubehör
Lichtraumprofil
Das L. gibt den Platz seitlich und oberhalb der Gleise
an, in den keine Teile der Lok oder der Wagen hineinragen
dürfen. Das L. ist in den meisten europäischen
Ländern unterschiedlich groß. Das Lademaß
kontrolliert die Einhaltung des L.
Siehe: Lademaß
LINT
Leichter innovativer Niederflur-Triebwagen
Lokalbahn
Eisenbahn für rein regionalen Verkehr
Lollo
Spitzname der Vorserienausführung der Diesellok V160
aufgrund ihres rundlichen Vorbaus
Lösche
Kohleteilchen, die durch den Saugzug im Kessel in die Rauchkammer
gerissen werden.
Lü
Lademaßüberschreitung
Ludmilla
Spitzname der in Rußland gebauten Großdiesellok
V300 DR (später BR 230/232/234 bei der DB)
LüK
Länge über Kupplung eines Fahrzeugs ohne Puffer,
sonst LüP, meist in mm
Siehe: LüP
LüP
Abk.: Länge über Puffer
Siehe: LüK
LZ
Abkürzung für Lokzug: auf einer Strecke einzeln
fahrende Lok.
LZB
Abkürzung für Linien-Zug-Beeinflussung. Die InduSi
wirkt nur dort, wo ein Gleismagnet ist. Mit der LZB ist
der Wirkungsbereich auf die gesamte Strecke ausgedehnt.
Ein in der Gleismitte verlaufendes Kabel überwacht
die Züge und liefert ihnen Informationen, wie z.B.
über die Signalstellung. Dies nennt man "elektronische
Sicht".
Maffei
Lokomotivfabrik in München
Magnetschienenbremse
Bremssystem, bei dem das Abbremsen durch Anpressen von
Bremsschuhen an den Schienenkopf erreicht wird.
MaK
Firma MaK (Maschinenbau Kiel)
Mallet
Dampflokomotive mit zwei gelenkig miteinander angetriebenen
Drehgestellen. Der Kessel ist am hinteren Drehgestell befestigt,
am vorderen nicht - er kann also seitlich ausschwenken.
(nach Ing. Anatole Mallet)
MAV
ungarische Eisenbahngesellschaft
Meyer
Bauart einer Gelenk-Dampflok ähnlich der Bauart Garret
mit einem Kessel im Gegensatz zur Bauart Fairlie mit zwei
Kesseln
Mitropa
Kurzwort für mitteleuropäische Schlafwagen- und
Speisewagen-Aktiengesellschaft. Das Unternehmen wurde schon
1916 gegründet. Bei der DR (DDR) blieb die Mitropa
erhalten.
MORA
Abkürzung für Marktorientiertes Angebot. MORA
besteht aus Einyelkomponenten wie z.B. MORA-C für DB-Cargo.
Ziel von MORA ist es unrentabele Leistungen zu streichen.
Morop
Abkürzung: Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde
Europas. Der 1954 in Genua gegründete Verband hat heute
etwa 55.000 Mitglieder.
N
Modelleisenbahn: Spurweite (9 mm), Maßstab 1:160
Naßdampflok
Bezeichnung der Bauart herkömmlicher Dampflokomotiven
im Gegensatz zur Heißdampf-Lok
NE
Abkürzung für nichtbundeseigene Eisenbahn
Nebenbahn (Nebenstrecke)
Eisenbahnstrecke mit geringerem Zugaufkommen, keine Schnellzüge.
Von Regional-, Nahverkehrs- und Güterzügen befahrene
Strecke. Gegenteil: Hauptstrecke.
NEM
Europäische Normen im Bereich der Modelleisenbahn.
Zum Beispiel: Spurweite H0 = 16,5 mm Spurweite N = 9 mm
Spurweite Z = 6,5 mm
NEM-Kupplung
Wagenkupplung nach NEM, auch zwischen Fabrikaten austauschbar,
da Aufnahmeschacht genormt
Nennleistung
Leistung einer Lokomotive im Dauerbetrieb. Die N. wird
in KW (Kilowatt) angegeben. Andere Leistungsdaten einer
Lok: Anfahrzugkraft - Bremskraft.
NMRA
Abkürzung National Modell Railroader Association,
Nationale Vereinigung der amerikanischen Modelleisenbahner,
meist kurz für die NMRA-Normen verwendet
NS
Abkürzung für Nederlandse Spoorwegen: Niederländische
Eisenbahnen.
NSB
Norges Statsbaner: Norwegische Staatsbahnen.
O
Hauptzeichen für offene Güterwagen
ÖBB
Abkürzung für österreichische Bundesbahnen.
Oberbau
Sammelbegriff für Gleis und Bettung. Die Bettung ist
jedoch nur der Schotter. Dämme, An-, Einschnitte sowie
Brücken gehören zum Unterbau. Vom Ober- wie vom
Unterbau hängt die Höchstgeschwindigkeit einer
Strecke ab.
Oberleitung
Anderes Wort für Fahrleitung.
Siehe: Fahrleitung
Öltender
zur Leistungssteigerung und zur Vereinfachung der Arbeit
des Heizers wurden Dampfloks auf Ölfeuerung umgebaut,
dabei erhielt der Tender einen geschlossenen Tank
ÖPNV
Abk.: Öffentlicher Personen-Nahverkehr
Orient Express
Ab 1883 befuhr der O. die Strecke Paris-Bukarest. Später
fuhren die luxeriösen Wagen des O. bis nach Istanbul
- insgesamt sind das 3.186 km. Nachdem der O. mehrmals eingestellt
und umbenannt wurde, fuhr er 1977 zum letzten Mal. Heute
verkehrt ein neuer Orient Express mit modernen Wagen von
Paris nach Bukarest über Stuttgart, München und
Wien.
P
Signaltafel "Pfeifen" (steht neben Eisenbahngleisen)
P 8
preuß. Ursprungsbezeichnung der Schlepptenderlok
BR 38
Pacific
Dampflok-Typ mit Achsfolge 2´C1´, wie z. B.
BR 01, 01.10, 03, 18.6
Pantograph
Stromabnehmer auf dem Dach elektrischer Triebfahrzeuge
mit verschiedenen Formen, z. B. als Scheren- oder Einholmabnehmer
Pbf
Abkürzung für Personenbahnhof
Pendolino
Triebzug, der mit ‘gleisbogenabhängiger Wagenkastensteuerung’
ausgerüstet ist. Hinter diesem Fachwort verbirgt sich
eine Hydraulik, die den P. in eine Schräglage in Kurven
von bis zu 10 Grad bringt. Die P. fahren in Italien seit
1971, die deutschen P., die seit 1991 fahren, tragen die
Baureihe 610.
Piktogramm
Symbole/Hinweisschilder, die die Orientierung erleichtern
sollen. Wenn z.B. ein Franzose auf einem deutschen Bahnhof
ein Schild mit der Aufschrift ‘Zu den Schließfächern’
sieht, versteht er es vermutlich nicht. Das P. dafür
ist leicht verständlich und sieht überall gleich
aus.
PKP
Polnische Eisenbahngesellschaft
Pleuelstange
Stange einer Dampflok, die die Kraft vom Zylinder auf die
Triebräder übertragt.
Pop-Farb-Wagen
bunte Reisezugwagen mit kieselgrauer Blende (Anfang Ep.
IV)
Siehe: Popfarben, Poplackierung, Popdesign
Popfarben, Poplackierung, Popdesign
Ende der sechziger Jahre liess die Deutsche Bundesbahn
ein neues Farbkonzept entwerfen. Dieses sah als Grundmuster
eine Aufteilung der Fahrzeugseiten in horizontal unterteilte
Farbfelder vor. Grundfarbe war kieselgrau, welches durch
ein grosses Farbfeld in einer wählbaren Farbe ergänzt
wurde. Diese waren u.a. Dunkelblau, Dunkelgrün, Orange
und Karminrot. Das Farbkonzept kam nur an Reisezugwagen
und Triebwagen zur Anwendung.
Prüfziffer, Prüfnummer
Die Prüfziffer gibt es seit der Einführung des
neuen Nummernschemas der DB (1968). Sie ist die 7. Ziffer
der Tfz.-Nummer. Die P. dient der Vermeidung von Eingabefehlern
an Computern. Die Prüfkontrollziffer wird ermittelt
durch abwechselnde Multiplikation aller Fahrzeugziffern
(ohne die Prüfziffer selbst) mit 1 und 2, der Bildung
der Quersumme aller bei der Multiplikation entstandenen
Ziffern und der Bestimmung der Differenz zur nächsten
(größeren) Zehnerstelle. Ein Programm mit dem
Prüfziffern berechnet werden finden Sie hier.
Puffer
Was ein Puffer ist, ist hinlänglich bekannt. Aber
es gibt verschiedene Puffer-Arten. Normalerweise haben Loks
und Wagen an jeder Seite 2 P. Bei Schmalspurbahnen sind
Mittelpuffer häufig verwendet, teilweise ist die Kupplung
in den Puffer integriert. Ein bekannter Typ von Mittelpuffer-Kupplungen
ist die Scharfenberg-Kupplung, die vor allem bei elektrischen
Nahverkehrstriebwagen eingesetzt wird.
Pullmann
George M. Pullmann baute ab 1859 luxuriöse Schlaf-
und Speisewagen, die als Pullmann-Wagen berühmt wurden.
Punktkontakt
Modelleisenbahn: Märklin-Mittelleiter, eingelassen
im Gleis.
Quertragwerk
Bestandteil der Oberleitung. In Bahnhöfen oder auf
mindestens viergleisigen Strecken wird die Fahrleitung vom
Q. getragen, welches zwischen zwei Turmmasten verspannt
ist.
R
Hauptkennung für Rungenwagen
Radsatz
Ein Radsatz besteht aus einer Achse und zwei Rädern.
Radsatz-Anordnung
Siehe unter Bauart und Achsfolge.
Rangierbahnhof
Bahnhof nur für Güterzüge. Hier werden die
Wagen nicht be- oder entladen, sondern nur in die richtige
Züge ‘einsortiert’. Damit dieses sogenannte
Rangieren einfacher ist, haben R. ein leichtes Gefälle,
so daß die Wagen ohne Lok, nur durch den Schwung zum
richtigen Zug rollen. In einem R. gibt es immer einen Ablaufberg
und eine Gleisharfe.
Rauchkammer
Vorderer Teil einer Dampflok, wo sich Dampfzuleitungsrohre,
Abblasrohr und Schornstein befinden.
Rbf
Abkürzung für Rangierbahnhof
Regler
Ventil einer Dampflok, mit dem die Dampfmenge zu den Zylindern
und damit die Geschwindigkeit geregelt werden kann.
Reko-Lok
überarbeiteter Lok-Typ ("Rekonstruktions-Lok")
der DR
Renfe
Red Nacional de los Ferrocariles Espagnoles - alles klar?
Das ist die Staatseisenbahn Spaniens.
Revision, Rev
Die regelmässige und intensive Wartung der Triebfahrzeuge
in bestimmten Zeitintervallen. Die Revisionen werden je
nach Intensität entweder von dem für das Fahrzeug
zuständigen Betriebshof, oder bei umfangreicheren Arbeiten
von einem Ausbesserungswerk durchgeführt. Im letzteren
Fall werden die Fahrzeuge meist in alle Einzelteile auseinander
genommen. Nach Prüfung, Reparatur oder Neubau von Einzelteilen
des Fahrzeugs, wird dieses wieder in einen Zustand versetzt
welcher einem Neubau gleichkommt.
RhB
Abkürzung: "Rhätische Bahn", Schweiz
(Schmalspur)
Rheingold
Berühmter deutscher Luxuszug, der von 1928 bis 1987
durchs Rheintal bis Genf fuhr. Der R. bestand nur aus 1.Klasse-Wagen.
Von 1962 an verkehrten von Amsterdam nach Genf wieder Rheingold-Züge,
aber mit modernen TEE-Wagen.
RIC
Abkürzung für Rigolamento Internationale Carozza.
Personenwagen-Austauschverfahren mehrerer europäischer
Bahnen
RIGA
Abkürzung für "Reisezuginstandhaltung in
Ganzzügen", die Wagen der einzelnen Züge
werden für Wartung und Reparatur als eine Einheit betrachtet.
RIV-EUROP
Abkürzung für Regolamento Internazionale Veicoli.
Güterwagen-Austauschverfahren mehrerer europäischer
Bahnen (seit 1951)
Rocket
Dampflok von George Stephenson (1829)
Roco
Modellbahnhersteller aus Salzburg (H0 und N)
Rohrblasgerüst
Einrichtung im BW, die zum Ausblasen der Kesselrohre einer
Dampflok dient. Das Rohrblasen mußte bei Dampfloks
einmal pro Woche vorgenommen werden, um zu starke Verschmutzungen
der Kesselrohre zu verhindern.
RoLa
Abkürzung für Rollende Landstraße. Die
RoLa ist ein System des Huckepack-Verkehrs. Transportsystem
im Güterverkehr, bei dem Lkw auf spezielle, extrem
niedrige Güterwagen hinauffahren und dann per Bahn
transportiert werden. Die RoLa-Züge fahren vor allen
in den Alpen, von Deutschland durch die Schweiz oder durch
österreich nach Italien und zurück.
S 3/6
Klassische bayerische Schnellzug-Schlepptenderlok
S-Bahn
Abk.: Schnellbahn; ÖPNV-System für Ballungsräume
Sandstreuer
Um das Durchdrehen der Räder auf nassen Schienen zu
vermeiden, wird vor die Triebräder Sand gestreut. Meist
geschieht das automatisch.
Saxonia
Name der ersten in Deutschland gebauten Dampflok (1838).
SBB
Abkürzung für Schweizerische Bundesbahnen.
Schaku
Siehe: Scharfenbergkupplung
Scharfenbergkupplung
Die Scharfenbergkupplung ermöglicht ein relativ einfaches
und schnelles Kuppeln und Entkuppeln von Fahrzeugen, der
Kupplungsvorgang vollzieht sich dabei automatisch. Die Scharfenbergkupplung
ermöglicht ohne grossen Aufwand aus den Einheiten Zugverbände
zu bilden und wieder aufzulösen, wobei mittels über
einen durch die Schaku durchgeleiteten Steuerstrom der gesamte
Zugverband von der Zugspitze aus überwacht und betrieben
werden kann. Die Schaku bündelt demzufolge sowohl die
mechanische wie die kommunikative Verbindung in einer Anlage.
Scharnow
Reiseunternehmen mit eigenen Wagen und Zügen in Ep.
III
Schiebebühne
Teil eines Bahnbetriebswerks zum Verschieben von Loks
Schienenzeppelin
Triebwagen, der durch einen Flugzeugmotor mit Propeller
angetrieben wurde. Der S. erreichte 1931 rund 230 km/h -
ein neuer Geschwindigkeitsweltrekord. Der S. wird nach seinem
Erfinder auch Kruckenberg-S. genannt.
Schleifkontakt
Stromzufuhr für die Lok über einen Kontakt am
Boden, der über ein Stromgleis schleift. Dieses System
ist in den meisten U-Bahnen verbreitet.
Schlepptenderlok
Dampflokomotive mit angehängtem Tender
Schleudern
das Durchdrehen der Treibräder eines Triebfahrzeugs
in Folge mangelnder Haftkraft
Schmalspurbahn
Eisenbahn, die auf Schmalspurgleisen fährt. Schmalspurgleise
sind Gleise mit geringerer Spurweite als die Normalspur.
Vorteil einer S. ist die Möglichkeit, sehr enge Kurven
zu durchfahren.
Schürzenwagen
Reisezugwagenbauart ab 1939; Wagenkästen durch "Schürzen"
nach unten verlängert
Schwan
Spitzname der Schnellzug-Dampflok BR 10 (Epoche III, DB)
Selectrix
Modelleisenbahn: Mehrzeugsteuerung für Modellbahnen,
von Trix entwickelt
Semmeringbahn
Die Gesamtlänge der Semmeringbahn ca. 42 Kilometer.
Die 895 m Seehöhe waren damals der höchste auf
Schienen erreichbare Punkt der Welt. Die Strecke weist 16
Viadukte, 15 Tunnel und über 100 steinerne Brücken
auf. 126 Mio. Ziegel und 80.000 Steinquader mussten herangeschafft
werden. 3,5 Mio. m³ Erdreich wurden bewegt und 1,4
Mio. m³ Fels gesprengt. Bis zu 20.000 Menschen waren
beschäftigt. 105 Jahre fuhren Dampflokomotiven über
den Semmering, bis 1959 die Strecke elektrifiziert wurde.
Die Strecke wurde in die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO
aufgenommen.
SEV
Abkürzung für Schienenersatzverkehr
Siemens, Ernst Werner von
(* 13. Dezember 1816 in Lenthe bei Hannover; † 6.
Dezember 1892 in Berlin) deutscher Erfinder, Begründer
der Elektrotechnik und Industrieller. baute u.a 1879 die
erste elektrische Eisenbahn, und 1881 die erste elektrische
Straßenbahn (beides in Berlin)
Sifa
Abkürzung für Sicherheits-Fahrschaltung. Di Sifa
dient der Überwachung des Lokführers. Dieser muß
alle 30 bis 60 Sekunden die Wachsamkeitstaste drücken,
sonst wird der Zug, nachdem eine Signalhupe ertönt
ist, zwangsgebremst.
Silberling
Nahverkehrswagen mit Wagenkasten aus nichtrostendem unlackiertem
Stahl mit Pfauenaugenmuster, ca. ab 1960
Sir Nigel Gresley
Britischer Eisenbahningenieur, der zahlreiche Dampflokomotiven
mit Stromverkleidung versah, darunter auch der "Mallard",
die 1938 den Geschwindigkeitsweltrekord für Dampfloks
aufstellte. Sie fuhr damals 202,7 km/h. Die Lok ist heute
noch betriebsfähig.
SJ
Abk.: Schwedische Staatsbahnen (Statens Järnväger)
SNCB
Abkürzung für Société Nationale
des Chemins de fer Belges: Nationale Gesellschaft der belgischen
Eisenbahnen.
SNCF
Abkürzung für Société Nationale
des Chemins de fer Francais: Nationale Gesellschaft der
französischen Eisenbahnen.
SOB
Abk.: "Südostbahn", Schweiz
Speichenrad
Gegensatz zum Scheibenrad, bei älteren Loks und Wagen
zu finden
Spurweite
Abstand der beiden Schienen eines Gleises. Spurweite von
mehr als 1.435 mm heißt Normalspur (in den Staaten
der ehemaligen Sowjetunion teilweise 1.524 mm). Spurweite
von weniger als 1.435 mm, früher auf Neben- und Gebirgsbahnen
üblich, heißt Schmalspur (BR 99). Spurweiten:
Normalspur = 1435 mm, Schmalspuren = 1000 mm oder auch 750
mm
Stephenson, Georg
Engl. Eisenbahningenieur, der die erste öffentliche
Eisenbahnstrecke der Welt (Stockton-Darlington) erbaute.
S. gründete die erste Lokomotivfabriok und lieferte
unter anderem auch den "Adler" (1. Lok in Deutschland)
aus.
Steppenpferd
Spitzname der leichten Schlepptenderlokomotive BR 24
Steuerwagen
Endwagen für Wendezüge mit Lokführerstand
im S-Bahn-, Nahverkehr, IR- und IC-Betrieb
Stirnlicht
Dritter (höher liegender) Scheinwerfer bei Triebfahrzeugen
und Steuerwagen
Streckenklasse
Die Eisenbahnstrecken sind in Klasse (je nach Belastbarkeit
in Tonnen pro Meter) eingeteilt. Es gibt drei Haupt-S.:
A, B und C. (siehe auch ABC-Raster)
Stromschale
Anderer Name der Stromlinien-Zusatzverkleidung bei Dampfloks
Stromsystem
In den einzelnen Ländern gibt es unterschiede in der
Spannung und der Art des Stroms (z.B. in Deutschland 15.000
Volt Wechselstrom und in Belgien 3.000 Volt Gleichstrom).
T
Wagen mit öffnungsfähigem Dach
T 18
Preuß. Tenderlokbaureihe, bei der DRG als BR 78 geführt
Taigatrommel
Spitzname der russischen Großdiesellok V200 der DR
wegen ihres hohen Fahrgeräuschs
Talgo
Auch Talgo Pendular genannter spanischer Zug, der sich
dadurch auszeichnet, daß er sich wie ein Pendolino
in die Kurve legen kann. Dies geschieht jedoch nicht über
eine Hydraulik, sondern dadurch, daß der Wagenkasten
an den Drehgestellen aufgehängt ist. Diese Technik
wird als "passive Wagenkastensteuerung" bezeichnet.
Der Talgo wurde bereits in den 70er Jahren entwickelt.
Tankwagen
Wagen, der der Beförderung von Flüssigkeiten
dient. Am häufigsten sind diese T. für öl,
Benzin und Gas eingesetzt, es gibt aber auch welche für
Wein, Milch oder Chemikalien.
Taurus
Vierachsige Hochleistungslokomotive, 1997 von der ÖBB
bei der Siemens AG bestellt, inzwischen auch bei anderen
Eisenbahngesellschaften im Einsatz.
TEE
TransEuropExpress ist der Name von komfortablen und damals
sehr modernen 1. Klasse-Zügen, ab 1957 vor allem in
Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und in Österreich
eingesetzt wurden.
TEN
Trans-Euro-Nacht (Schlafwagenpool mehrerer europ. Bahnen)
Tender
Anhänger, der hinter einer Dampflok ist und Kohle
und Wasser geladen hat. Kleinere Lok, auch Tenderlokomotiven
genannt, hatten meist an der Lok einen Kohlen- und Wasserkasten
angebaut, weil der Verbrauch geringer war als bei den größeren
Schnellzugloks, den sogenannten Schlepptenderlokomotiven.
Tenderlok
Kleine Dampflok mit Tender am Kessel oder direkt hinter
dem Führerstand, ohne Schlepptender, früher auf
Nebenbahnen oder zu Rangierzwecken im Einsatz.
Tf
Abkürzung für Triebfahrzeugführer
Tfz
Abkürzung für Triebfahrzeug
TGV
Train a grande Vitesse, Französischer Hochgeschwindigkeitszug
Touristik-Zug
1.) Zug großer Reiseunternehmen in den 50er/60er
Jahren;
2.) bunter Reisezug der DB (ab 1995)
Touropa
Reiseunternehmen mit eigenen Wagen und Zügen, in Ep.
III
Transalpin
Elektrotriebzug der ÖBB, in zwei Ausführungen
Treibachse
Angetriebene Achse eines Triebfahrzeugs
Siehe: Bauart und Achsfolge
Triebfahrzeug
Schienengebundenes Fahrzeug, das sich aus eigener Kraft
bewegen kann: Lokomotive (ohne Beförderungsfunktion
in der Lok) oder Triebwagen (mit Beförderung von Personen
oder Gütern im Triebwagen), inzwischen auch Triebkopf,
desweiteren Nebenfahrzeuge mit eigenem Antrieb
Triebfahrzeugführer, Tf
Der Triebfahrzeugführer (Tf), also der Lokführer,
bedient eigentlich die Lok und beobachtet die Signale.
Triebfahrzeugpersonal
Zum Triebfahrzeugpersonal gehören Triebfahrzeugführer(Tf)
Triebfahrzeugbegleiter.
Triebwagen
Schienengebundenes Fahrzeug, das sich aus eigener Kraft
bewegen kann mit Beförderung von Personen oder Gütern
TT
Modelleisenbahn: Spurweite 12 mm, Maßstab 1:120
Übergangs-Kriegslok
Die ÜK waren stark vereinfachte Ausführungen
bereits existierender Baureihen Beispiele für ÜK:
Baureihen 52 und 42
Uerdinger
Bezeichnung für die meist roten Schienenbusse VT 95
nach ihrem ersten Bauort, der Waggonfabrik Uerdingen
UIC
Abkürzung für "Union international de chemins
de fer": Internationaler Eisenbahnverband. 1992 in
Paris gegründete Organisation. 42 Bahnen aus Europa,
Afrike und Amerika sind beigetreten.
ÜK
Abkürzung: Übergangs-Kriegslok
Siehe: Übergangs-Kriegslok
Umbauwagen
Wagen, die von der DB bzw. DR nach dem 2. Weltkrieg umgebaut
wurden. Die meist aus der Länderbahnzeit stammenden
Wagen hatten Holzaufbauten, die durch stählerne Wagenkästen
ersetzt wurden. Die Inneneinrichtungen wurden erneuert wurden.
Umlauf, Umlaufplan
Einsatz einer Lok/eines Wagens. Ein U. dauert oft mehrere
Tage, vor allem bei Lokomotiven. Beispiel für dem U.
einer Lok: Sie fährt von München nach Hamburg,
anschließend nach Berlin. Am nächsten Tag geht’s
weiter nach Stuttgart. Dann fährt sie wieder nach München
zurück, um für den nächsten U. vorbereitet
zu werden.
Unterbau
Teil des Bahnkörpers, der den Oberbau trägt.
Der U. gleicht Unebenheiten des Geländes aus. Beispiel
für den U. : Dämme, An- und Einschnitte, Stützmauern,
Brücken und Tunnel.
Unterflurantrieb
Antrieb (Elektro- oder Dieselmotor) liegt unterhalb des
Bodens (Flur). Der U. wird vor allem in Straßenbahnen,
aber auch in modernen Dieseltriebwagen eingesetzt, z.B.
bei der Baureihe 628/928 der DB.
V 200
Klassische Groß-Diesellok
Verbunddampflok
Dampflok mit parallel oder hintereinander geschalteten
Zylindern, was eine bessere Ausnutzung des Dampfdrucks ermöglicht.
Vierkuppler
Dampflokomotive mit je vier über Kuppelstangen verbundenen
Treibrädern.
Vizinalbahn
in Bayern gebräuchlich gewesene Bezeichnung für
Lokalbahn oder Kleinbahn
Vorserie
(auch Prototyp genannt), erste Lokomotive einer Baureihe,
die der Erprobung der Fahreigenschaften dient. Nachdem die
Tests erfolgreich beendet sind und das Tfz sich bewährt
hat, wird die meist leicht modifizierte Serienversion produziert.
Vorsignal
Signal, welches die Signalstellung des Hauptsignals anzeigt.
Da der Bremsweg eines Zuges normalerweise ca. 1000 m beträgt,
wird das V. meist in diesem Abstand vor dem Hauptsignal
aufgestellt. Nur in Einzelfällen steht das V. in geringerem
Abstand (z.B. 750 m).
Vorsignalwiederholer
Ein V. steht immer dann nach einem Vorsignal, wenn das
Hauptsignal aus 400 m Entfernung noch nicht zu sehen ist
(z.B. in Kurven oder Tunnel). Ein V. ist mit einem speziellen
Schild gekennzeichnet. V. gibt es nur bei Lichtsignalen.
VR
Abkürzung für Valtionrautatiet Rautatiehalitus:
Finnische Staatsbahnen.
Vsig
Abkürzung für Vorsignal
VT
Abkürzung für Verbrennungstriebwagen.
VTG
Abk. der Vereinigten Tankwagen Gesellschaft (Kesselwagenverbund)
W
Wartezeichen im Bahnhofs- und Bw-Bereich (orangefarbenes
W)
Wagner-Windleitbleche
Bleche seitlich der Dampflok-Kessel, heruntergezogen auf
den Lokomotiv-Rahmen (in Epoche II üblich); umgangform.
"große Ohren"
Wannentender
Tender mit wannenförmigem Kasten, üblich bei
verschiedenen Modellen der BR 38, 50 und 52
Wasserkran
Einrichtung in Bahnhöfen und BW's, die dazu dient,
den Wasservorrat einer Dampflok aufzufüllen.
Wasserturm
Einrichtung in BW's, die dem Wasserkran das benötigte
Brauchwasser zur Verfügung stellt. Wegen dem hohen
Wasserbedarf wird kein normales Trinkwasser benutzt.
Weichenfeld
Mehrere hintereinander liegende Weichen, die den Zug, die
Lok oder die Wagen auf das richtige Gleis bringen. Ein W.
findet man hinter fast jedem Ablaufberg, aber auch in Ein-
und Ausfahrten fast aller Bahnhöfe.
Windleitblech
Seitlich an der Dampflokomotive angebrachtes Blech, welches
die Lok 'windschnittiger' gestaltet. W. sind erst bei der
DB an die Dampfloks montiert worden.
Wismarer Schienenbus
Nebenbahn-Schienenbus mit keilförmigen Vorbauten an
beiden Seiten, deshalb Spitznamen wie "Schweineschnäuzchen"
und "Ameisenbär"
Witte-Windleitbleche
Bleche seitlich der Dampflok-Kessel, als schmale Parallelogramme
(nach Ing. Witte, üblich in Ep. III/IV)
X
Abkürzung für Achse
Y-Weiche
Siehe: Außenbogenweiche
Z
Modelleisenbahn: Spurweite 6,5 mm, Maßstab 1:220
(kleinste serienmäßige Modelle)
Z, Z-gestellt
Abkürzung für von der Instandhaltung zurückgestellt.
Zahnradbahn
Eisenbahn, die wegen großer Steigung mit Zahnstangen
ausgerüstet ist. Die Zahnradlokomotiven besitzen zwischen
den Rädern noch ein zusätzliches Zahnrad, das
in die Zahnstange greift. Auf Z. kann nur eine sehr geringe
Geschwindigkeit gefahren werden (maximal 25 km/h). Die Steigung
auf Z. beträgt 100 bis max. 480 %. (sprich pro Mille).
Wenn eine Strecke um 100 %. ansteigt, dann heißt das,
die Strecke steigt jede 1000 Meter um 100 Meter an.
Zahnstange
Bauteil in der Mitte des Gleises einer Zahnradbahn in unterschiedlichen
Ausführungen
Zinkpest
Die wegen ihrer hohen Dichte für Lokgehäuse verwendete
Zinklegierung der Nachkriegsjahre wies bisweilen zu hohe
Blei- und Kupferanteile auf (Verunreinigungen), was zum
langsamen "Zerbröseln" des Bauteils führt
Zugbahnfunk
1.Lautsprecheranlage zur Übertragung von Musik und
Mitteilungen an die Reisenden
2. Funksystem in Tfz, welches zur Kontaktaufnahme mit dem
Stellwerk oder Bahnhof etc. dient.
Zugbegleiter, ZUB
Zu den Zugbegleitern gehören Zugführer und Zugschaffner.
Zugführer, Zf
Der Zugführer (Zf) ist für die Fahrt des Zuges
verantwortlich, erteilt also z.B. den Abfahrauftrag. Im
Normalfall hält er sich im Fahrgastraum auf. Oft (besonders
in Triebwagen) ist der Triebfahrzeugführer jedoch gleichzeitig
Zugführer, er erteilt sich also den Abfahrauftrag praktisch
selbst.
Siehe: Triebfahrzeugführer, Tf
Zuglauf
Weg eines Zuges vom Start- zum Zielbahnhof, über die
einzelnen Zwischenstationen. Wagen, die nicht dem gesamten
Z. folgen, werden Kurswagen genannt.
Siehe: Kurswagen
Zugpersonal
Das Zugpersonal besteht aus dem Triebfahrzeugpersonal und
den Zugbegleitern. Das Zugpersonal untersteht dem Zugführer,
während des Aufenthalts auf Bahnhöfen außerdem
dem Fahrdienstleiter. Bei Zügen ohne Zugbegleiter,
übernimmt der Triebfahrzeugführer des ersten arbeitenden
Triebfahrzeugs, die Aufgaben des Zugführers.
Zugschaffner, (Zs)
Der Zugschaffner (Zs), ist der Helfer des Zugführers,
der zusätzlich zum Zf die Reisenden betreut, Fahrausweise
kontrolliert, etc. Bei der Abfahrt melden die Zugschaffner
lediglich mit ihrer roten Scheibe, daß der Zug aus
ihrer Sicht abfahrbereit ist. Den eigentlichen Auftrag zum
Abfahren erteilt aber der Zugführer mit der grünen
Kelle bzw. durch Anschalten des Abfahrsignales (grüner
Kreis als Lichtsignal, Zp9).
Zylinder
Teil einer Dampflok, in dem die Kraft des Dampfdrucks in
eine Hin- und Her-Bewegung umgewandelt wird.
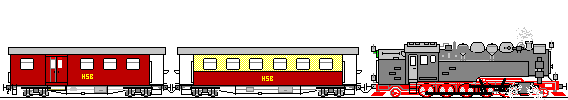

|